
Die Schnittstelle zwischen KomplementärTherapie (KT) und Psychotherapie (PT) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Beide Disziplinen, insbesondere wenn es sich um Körperpsychotherapie (KPT) handelt, begegnen dem Menschen in seiner Ganzheit – und doch unterscheiden sie sich massgeblich. Diese Unterschiede zwischen KT und KPT werden dabei sowohl durch methodische Ansätze aber vorallem auch durch die verschiedenen Bedürfnisse der Klient:innen definiert.
Zielgruppen und Wirkebenen
Die KT eignet sich insbesondere für Menschen mit einer stabileren Selbststruktur, die über grundlegende Fähigkeiten zur Selbstreflexion, Beziehungsfähigkeit und Selbstwahrnehmung verfügen. Hier kann KT unterstützend wirken, um die Selbstkompetenz zu stärken und den Umgang mit inneren und äusseren Konfliktenzu fördern.
Bleibt eine nachhaltige Veränderung jedoch aus oder verstärkt sich eine Symptomatik,sind weiterführende Abklärungen angezeigt. Abhängig von der Komplexität der Situation und dem Leidensdruck kann eine psychotherapeutische Behandlung unbedingt angezeigt sein.
Abklärung und Triage
In einer ersten Triage wird geprüft, ob eine Person mit ihrem Anliegen in der Psychotherapie besser aufgehoben ist. Dabei kann es sich auch um eine kurzzeitige Krisenintervention handeln, die z.B. im Rahmen eines Coachings, etwa nach dem IBP-Ansatz (Integrative Body Psychotherapy), adäquat durchgeführt werden kann.
Zeigt sich jedoch ein anhaltender Leidensdruck, folgen umfassende diagnostische Abklärungen. Es rückt nun die Suche nach pathogenetischen Faktoren in den Vordergrund – also nach den Ursachen, die zur Entstehung dieser psychischen Belastungen beigetragen haben. Diese Diagnostik beeinflusst sowohl die Wahl der therapeutischen Intervention als auch die Frage, ob die Behandlung über die Grundversicherung abgerechnet werden kann.
Unterschiedliche Ausgangslagen in der Psychotherapie
PsychotherapeutinJudith Biberstein beschreibt zwei grundlegende Ausgangslagen:
Im zweiten Fall geht es weniger um Konfliktbearbeitung als um den Aufbau von Handlungskompetenzen und inneren Strukturen.
Kommen Menschen mit solchen tiefen, pathogenen Voraussetzungen in die KT, können wir ihnen mit der KT auf der Ebene der Regulation und des Beziehungsangebots begegnen: Wir schaffen Sicherheit, fördern Präsenz und ermöglichen korrigierende Erfahrungen – jedoch stets in dem Bewusstsein, dass eine psychotherapeutische Begleitung für tiefgreifende Veränderungsprozesse unerlässlich bleibt.
Gemeinsame Haltung – unterschiedliche Werkzeuge
KT und KPT teilen eine ähnliche Grundhaltung: Beide streben eine Ganzwerdung des Menschen an – eine Verbindung zum inneren Kern und die Förderung des Potenzials, das in jedem Menschen angelegt ist. Die therapeutische Beziehung bildet dabei in beiden Disziplinen den zentralen Wirkfaktor.
Die Arbeitsmethoden unterscheiden sich jedoch deutlich. Während die KT primär über Berührung, Körperwahrnehmung und Regulation arbeitet, nutzt die KPT unter anderem gezielte Inszenierungen und Probehandlungen, um z.B. wiederkehrende Beziehungsmuster sichtbar und veränderbar zu machen. Klient:innen lernen, neue Ausdrucksformen und Handlungsmöglichkeiten zu erproben.
Die Bedeutung der Lebensgeschichte
In der PT wird die Lebensgeschichte eines Menschen umfassend erhoben – sowohl zur Bearbeitung von Themen als auch, um ein Bewusstsein zu schaffen: Ich habe eine Geschichte, aber ich bin nicht meine Geschichte.
Die PT arbeitet zudem stark mit der Zeitdimension. Über regressive Methoden werden frühere Entwicklungsphasen therapeutisch zugänglich gemacht, um dort liegende Konflikte oder Traumata zu bearbeiten und wieder in die heutige Zeit zu integrieren.
In der KT spielt die Geschichte vor allem insofern eine Rolle, als sie sich im Körper ausdrückt – als energetisches oder somatisches Muster, das durch achtsame Körperarbeit erfahrbar und veränderbar wird. Wir benennen, was gespürt, gefühlt oder gedacht wird, und begleiten den Prozess der Veränderung im Körper. Dabei bleibt der Fokus stets auf der Rückkehr ins Hier und Jetzt.
Sprache als therapeutisches Instrument
Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Rolle der Sprache. In der PT dient sie als primäres Werkzeug, um Unbewusstes bewusst zu machen und Worte für vormals sprachlose Erfahrungen zu finden.
In der KT hingegen ist Sprache häufig ergänzend – sie unterstützt die Bewusstwerdung, ohne den Körper aus dem Fokus zu verlieren. Worte können hier eine Form der „verbalen Berührung“ darstellen und den Prozess der Integration begleiten.
Zusammenarbeit als Ressource
Beide Fachrichtungen ergänzen sich in idealer Weise. Eine interprofessionelle Zusammenarbeit eröffnet für Klient:innen wie Fachpersonen ein grosses Potenzial. In Zeiten einer zunehmenden Versorgungskrise im psychotherapeutischen Bereich kann die KT – mit entsprechenderZusatzqualifikation – Menschen in akuten Notlagen stabilisierend begleiten und ihre Ressourcen aktivieren.
Dieses Angebot ist in diesem Fall als überbrückende Unterstützung zu verstehen, bis eine psychotherapeutische Behandlung aufgenommen werden kann. Ein solchesZusammenspiel vermittelt Betroffenen das Gefühl, nicht allein zu sein, sondern von einem tragenden Netzwerk begleitet zu werden – ein zentraler Faktor für Vertrauen, Selbstwirksamkeit und Genesung.
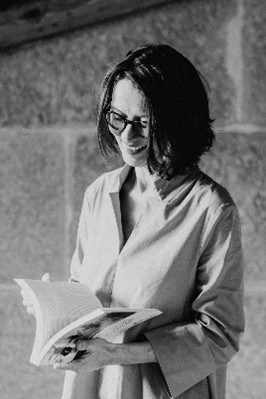
Meine heutige Gesprächspartnerin:
Judith Biberstein führt eine psychotherapeutische Praxis und ist Mutter eines Sohnes. Als Teamleiterin der Berner Zweigstelle des IBP-Zentrums für psychische Gesundheit trägt sie Verantwortung für die fachliche und organisatorische Leitung. Zudem engagiert sie sich in der Kommission für Qualitätssicherung der Charta für Psychotherapie und berät das Themenhaus für Bindung und Resilienz am Bollwerk21 in Bern. Als Dozentin, Lehrtherapeutin und Supervisorin bildet sie angehende Körperpsychotherapeut:innen am IBP-Institut sowie an weiteren Fachhochschulen wie der ZHAW (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft) und dem AIM (Akademie für Verhaltenstherapie und Methodenintegration) aus. Darüber hinaus wirkt sie in Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung des IBP-Instituts und begleitet Einzelpersonen und Teams in Supervision und Erwachsenenbildung.
https://inneremraumgeben.ch
WeiterführendeLinks:
Integrativ Body Psychotherapie, IBP Institut Schweiz: https://ibp-institut.ch/koerperpsychotherapie/
Jack Rosenberg: https://proactivemindfulness.com/rosenberg-kitaen/
TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises): https://treglobal.org/
SE (Somatic Experiencing): https://www.somatic-experiencing.de/was-ist-somatic-experiencing/